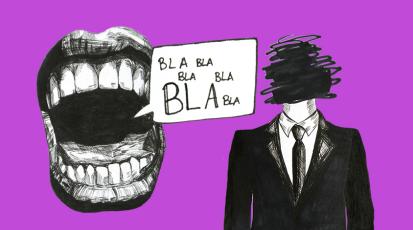Der Manbun-Moralist in der Fußgängerzone
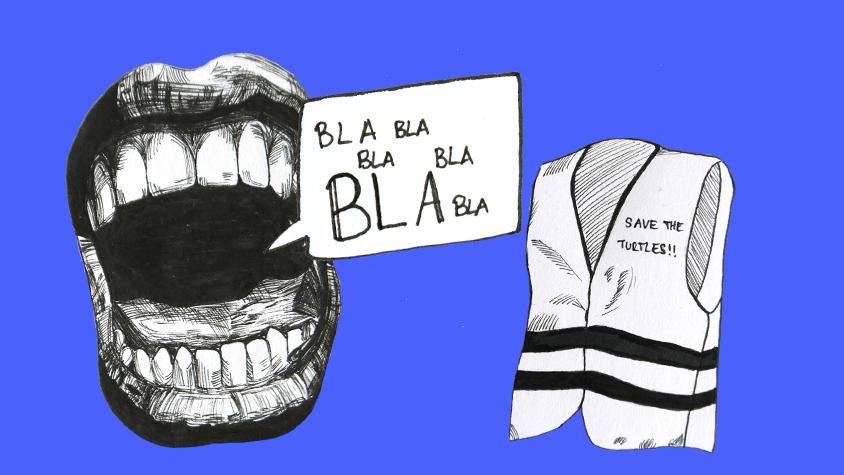
Es ist 17:38 Uhr, an irgendeinem Wochentag in der überfüllten Innenstadt. Der Geruch von fettigem Essen, Nagelstudios und Abgasen vermischt sich mit dem Klang von Stimmengewirr, Hupen und der Musik, die aus Fast-Fashion-Stores dröhnt, zu einer Symphonie der Reizüberflutung. Mein Kopf fühlt sich schwer an, als ich mich Schritt für Schritt durch das Meer an Sinneswahrnehmungen manövriere und mich meinem Ziel nähere: Der U-Bahn-Station, die mich nach diesem langen, schwülen Tag nach Hause (sprich: zur ersehnten Gammel-Session auf der Couch) bringen wird. Im Wimmelbild aus Menschen, Essensständen und Markenlogos erblicke ich das Schild der U-Bahn-Station wie ein Licht am Ende eines düsteren Tunnels. Doch ein Schatten verdunkelt das Licht: Ein Mitte-20-Jähriger, ausgestattet mit Manbun, Weste und einem Flyer in der Hand. „Hey, warte mal! Darf ich dich für zwei Minuten stören?“, ruft er, während er mir mit einem etwas unbeholfenem Hopser den Weg versperrt. Und bevor ich mir überhaupt selbst die Frage stellen kann, ob ich mein People-pleasertum ausnahmsweise beiseiteschieben und mit einem unsensiblen „Nein“ die Szenerie verlassen soll, hat er bereits angefangen, mich vollzulabern. Über Tierschutz, Flutkatastrophen oder die humanitäre Lage in Kriegsgebieten – ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Guilt-tripping als Businessmodell
Volunteers von Spendenorganisationen sind wie kleine Bojen in der Flut unseres spätkapitalistischen Ozeans, die uns daran erinnern, welche Auswirkungen die Konsumexzesse und Wirtschaftsmaßnahmen westlicher Industrienationen auf den Rest der Welt und unsere Umwelt ausüben. Und obwohl uns diese unbequemen Realitäten immer wieder aufwecken und uns globale Ungerechtigkeiten vergegenwärtigen, bedienen sich Spendenorganisationen eines fragwürdigen Geschäftsmodells: Sie konstruieren die Vorstellung, dass die Normalos in der Fußgängerzone für all diese Ungleichheiten persönlich verantwortlich sind. Und dass unsere Sünden umkehrbar sind, wenn man doch nur die letzten paar Euro, die am Ende des Monats übrigbleiben, an einen wohltätigen Zweck spendet.
Die Frage der Verantwortung
„Dir ist das Tierleid also egal?“ wird einem gerne mal unterstellt, wenn man versucht, dem Verkaufsgespräch zu entfliehen. Doch die Wirklichkeit ist etwas komplexer: Der Student mit Manbun und Weste, der mir moralische Verkommenheit unterstellt, tut dies weniger aus eigener ethischer Überzeugung, sondern weil er – genau wie ich – ein überteuertes WG-Zimmer, Einkäufe, Studienbeiträge und das eine oder andere Bierchen finanzieren muss. Während die 50 reichsten Milliardär*innen durchschnittlich in 90 Minuten mehr Treibhausgase in die Welt pusten als der Durchschnittsmensch in seinem ganzen Leben, fröhlich Rüstungsaktien shoppen und Steuern hinterziehen, sollen dahergelaufene Studis, 9-to-5-Jobber*innen und Geringverdienende das daraus resultierende Leid geradebiegen.
Um die Frage meines Weggenossen zu beantworten: Nein, mir ist das Tierleid nicht egal. Genauso wenig wie mir der Klimawandel, Kinderarmut oder die humanitäre Lage in Kriegsgebieten egal sind. Ich stelle auch nicht infrage, dass Spendenorganisationen wichtige Arbeit leisten und eine durchaus legitime Daseinsberechtigung besitzen. Was ich hingegen infrage stelle? Inwiefern die Welt zu einem besseren Ort wird, wenn man studentische Minijobber*innen in Fußgängerzonen stellt, um andere Studierende mit Schuldzuweisungen zuzulabern. Anstatt diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die die besagten Ungerechtigkeiten überhaupt erst erzeugt haben.