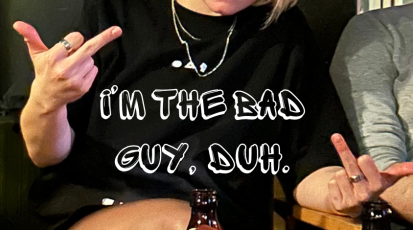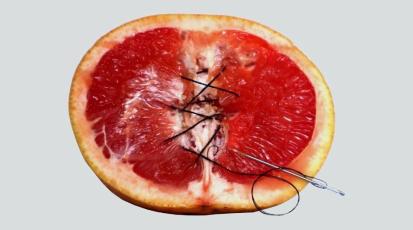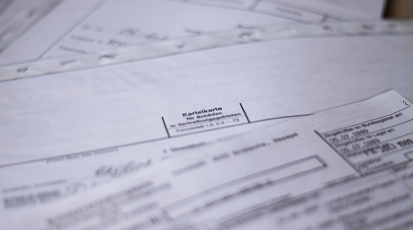„Er ist kein guter Mensch.“
Jeden Donnerstag fahre ich ins Haus meiner Eltern, koche etwas und trage dann zwei Portionen des Essens über die Straße in die Wohnung meiner Oma. Als ich die Tür öffne, steigt mir ein vertrauter Duft in die Nase, es riecht nach Orchideen, Kamillentee und Kernseife, ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückversetzt.
Ich gehe ins Esszimmer. Oma sitzt schon am Tisch, wartet mit einem warmen Lächeln auf mich. Sie nimmt mich in den Arm – eine große Frau, die auch mit 88 Jahren noch stark wirkt, der man ansieht, dass sie vom Leben gezeichnet ist. Eine Frau, deren Gesicht die Spuren eines langen Lebens trägt - feine Linien, die von Freude und Kummer erzählen, tiefe Falten, die gelebte Geschichten bewahren. Ihre Hände, von harter Arbeit geprägt, sind zugleich zart und fest, ein Symbol der Stärke, die sie ein Leben lang begleitet hat.
Kindheit im Schatten des Krieges
Gertrud Augsten, von uns nur liebevoll „ Oma“ genannt, wurde 1936 in Friedland geboren – einer Stadt, die damals noch zur Tschechoslowakei gehörte, aber von deutschsprachiger Bevölkerung bewohnt wurde.
Als Adolf Hitler durch Friedland marschierte, war sie noch ein Kleinkind, gerade mal drei Jahre alt. Trotzdem glaubt sie, Erinnerungen an diesen Tag zu haben: Die meisten Menschen seien auf die Straße gegangen, um einen Blick auf Hitler zu erhaschen – aber nicht ihre Familie. Weder ihr Vater noch ihre Mutter hätten sich unter die Menge gemischt. Da ihr Haus nur wenige Häuser von der Hauptstraße entfernt lag, seien sie lediglich bis zur Ecke gegangen, um von dort aus einen Blick auf das Geschehen zu werfen. Natürlich habe sie damals nicht genau verstanden, was geschah. Doch wenn es um diesen Hitler ging, war ihr immer klar: „Er ist kein guter Mensch.“ Wahrscheinlich war das ein Gefühl, das sie von ihren Eltern übernahm.
Ihr Vater, mein Urgroßvater, der den Ersten Weltkrieg, die Kriegsgefangenschaft in Albanien und eine Malariaerkrankung überlebt hatte, hielt sich von den Nazis fern. „Krieg ist das Schlimmste, was passieren kann“, habe er oft gesagt, erzählt meine Oma – und in ihrer Stimme schwingt leiser Stolz mit.
Friedland blieb zunächst weitestgehend verschont, wurde dann aber doch in den letzten Kriegswochen bombardiert. Aber auch ohne die Angriffe war der Krieg allgegenwärtig. Meine Oma erinnert sich noch an eine Szene aus ihrer Kindheit im NS-Staat: „Meine Schwester und ich haben heimlich Brot an Kriegsgefangene gesteckt, die in gestreiften Anzügen durch die Straßen geführt wurden. Sie haben kaum gesprochen. Nur genickt. Wir haben uns versteckt, weil wir wussten, dass es gefährlich war.“ Ungefähr sieben Jahre muss sie damals alt gewesen sein.
Während meine Oma erzählt, schaut sie mich immer wieder an. Ihre Augen, von der Zeit umrahmt, strahlen eine stille Weisheit aus. Sie haben viel gesehen, viel ertragen und doch nie ihren warmen Glanz verloren. Sie ist eine Frau, die gelebt hat, geliebt hat und niemals aufgegeben hat.
Die Begegnung mit dem sowjetischen Soldaten
Frühjahr 1945. Immer wieder gingen Gerüchte um, dass sich die sowjetischen Truppen näherten. Dann kamen sie wirklich.
Meine Oma erzählt, dass sie nie Angst vor den sowjetischen Soldaten hatte. Anders als viele andere erlebte sie keine direkte Bedrohung durch sie. Heute spricht sie ohne Groll über diese Zeit. Vielleicht, weil ihr eigene Begegnungen gezeigt haben, dass nicht alle Soldaten Feinde waren. Sie erinnert sich nicht an direkte Angriffe auf ihre Familie, aber an einen Nachmittag, an dem sie mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Ein sowjetischer Soldat hielt sie auf. Er zeigte auf das Rad, machte mit den Armen eine fahrende Bewegung. Sie verstand. Er konnte nicht Fahrrad fahren. Sie zeigte es ihm. Ohne Worte, nur mit Gesten. Erst wackelte er, dann fuhr er ein paar Meter, dann stieß er einen triumphierenden Ruf aus. „Dann wollte er mir ein Pony schenken“, erzählt sie heute lachend. „Was hätte ich denn mit einem Pony gewollt?“
Nachkriegszeit: Zu Fremden im eigenen Zuhause
Mit der Kapitulation Deutschlands 1945 begann eine neue, noch unsichere Zeit. Die Beneš-Dekrete erklärten alle Sudetendeutschen zu Staatsfeinden. Viele wurden innerhalb von zwei Jahren zwangsausgesiedelt – aber nicht alle.
Die Beneš-Dekrete sind eine Serie von 143 Verordnungen, die zwischen 1940 und 1945 vom tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš erlassen wurden. Diese Dekrete wurden zunächst im Londoner Exil und nach Kriegsende in Prag verabschiedet. Sie bildeten die rechtliche Grundlage für die Enteignung und Vertreibung von etwa drei Millionen Deutschen und Ungarn aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Dekrete führten zur Enteignung und Vertreibung der deutschen und ungarischen Minderheiten in der Tschechoslowakei.
Die Dekrete betrafen verschiedene Bereiche, darunter die Aberkennung der Staatsbürgerschaft, die Konfiszierung von Eigentum und die Bestrafung von Personen, die mit dem nationalsozialistischen Regime kollaboriert hatten.
Die Beneš-Dekrete sind bis heute ein kontroverses Thema in den Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und den betroffenen Ländern, insbesondere Deutschland und Ungarn. Diskussionen über ihre Gültigkeit und mögliche Aufhebung dauern an.
„Wir wurden nicht vertrieben, aber wir waren plötzlich Fremde in unserem eigenen Land.“ Viele Deutsche verloren ihre Häuser und ihre Staatsbürgerschaft. Deutsche Schulen wurden geschlossen. Wer bleiben wollte, musste sich anpassen. Um zu verstehen, warum meine Oma und ihre Familie plötzlich als Fremde galten, lohnt sich ein Blick auf die Grenzen der Region.
Meine Oma lernte Tschechisch und Russisch in der Schule, aber Deutsch wurde nur noch zu Hause unterrichtet. „Meine Schwester hat mir Unterricht gegeben“, erinnert sie sich.
Der Tag am Bahnhof
Immer wieder wurden Deutsche für Zwangsarbeit ins Landesinnere gebracht, oft ohne zu wissen, ob sie jemals zurückkehren würden. An diesem Tag war meine Oma am Bahnhof, um einem guten Freund der Familie zu helfen, der mit seinen 70 Jahren Unterstützung beim Tragen seines Gepäcks brauchte.
Der Bahnhof war voller Menschen, die hastig Abschied nahmen. Sie begleitete den Freund bis zum Waggon – dann, gerade als sie sich umdrehen wollte, durchbrach ein metallisches Geräusch die Luft: Die Türendes Bahnhofs schlugen zu.
Ein Moment der Schockstarre. Um sie herum wurde gedrängt, gerufen, geschoben. Und sie stand plötzlich mitten auf dem Bahnsteig, gefangen zwischen all den Abreisenden. „Ich wusste: Wenn ich jetzt in diesen Zug steige, komme ich nie wieder zurück.“ Keine Zeit für Angst. Keine Zeit für Zweifel. Ohne nachzudenken, ließ sie sich fallen, robbte unter einen abgestellten Waggon. Dann – ein Ruck. Sie zog sich hervor, sprang auf die Füße und rannte. Einfach nur weg.
Heute erzählt sie diese Geschichte mit einer bemerkenswerten Ruhe. Kaum Emotionen in ihrer Stimme, kein Zögern in ihrer Erzählung. Sie wusste, was sie tun musste. Und sie tat es.
Ausbildung, Arbeit und Liebe
Trotz aller Widrigkeiten schaffte es meine Oma, eine Ausbildung zur Bautechnikerin zu absolvieren – ein Beruf, den damals kaum eine Frau ergriff. „Wir mussten doppelt so viel wissen wie die Männer, um anerkannt zu werden“, sagt sie mit Stolz in der Stimme, da sie es geschafft hatte. Nicht nur während der Ausbildung, sondern auch später im Berufsleben arbeitete sie für einen Architekten und erwarb sich Ansehen.
Während ihrer Ausbildung, an einem kalten Silvesterabend, war sie mit ihrer Familie zu Besuch bei einer anderen deutschen Familie – der Familie meines Opas.
Er fragte sie an diesem Abend, ob er ihr schreiben könne. Er musste zurück zum Militär. Zwei Jahre lang schrieben sie sich Briefe. Nach dem Tod meines Opas hat sie alle Briefe noch einmal gelesen – und danach vernichtet. „Was wir geschrieben hatten, war privat. Das geht niemanden sonst etwas an.“
Nach seiner Zeit beim Militär trafen sie sich heimlich. Ihr Vater war gegen jede Verbindung, die nicht von ihm abgesegnet war, und ihre Mutter half ihr, die Treffen zu organisieren. „Mein Vater war gegen alles – vor allem gegen Männer“, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln. Mein Opa war ihre große Liebe und dafür hat sie auch die Beziehung zu ihrem Vater aufs Spiel gesetzt.
Der Abschied – Aufbruch in eine ungewisse Zukunft
Die 1960er Jahre. Eine Entscheidung, die alles verändern würde. Meine Großeltern wussten: Ihre Kinder sollten eine bessere Zukunft haben – eine Zukunft, die hier, in ihrer alten Heimat, nicht mehr möglich war. Also trafen sie eine Wahl, die viele vor ihnen und viele nach ihnen treffen mussten. Peter, mein Onkel, war sieben Jahre alt. Alt genug, um zu verstehen, dass etwas Endgültiges geschah. Karin, meine Mutter, gerade ein Jahr alt, zu klein, um zu begreifen, dass sie ihre ersten Schritte in einem neuen Land machen würde.
Sie packten das Nötigste. Kein großes Gepäck, nur das, was in einen halben Waggon passte. Was zu viel war, blieb zurück – ihr Haus, Nachbarn, die Familie, eine ganze Vergangenheit. Es gab keine große Verabschiedung. Keine langen Umarmungen, keine letzten Worte. Kein Blick zurück.
Der Zug ratterte durch die Landschaft. Wiesen, Hügel, kleine Dörfer. Die Zukunft lag auf der anderen Seite der Grenze. „Ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht“, sagt meine Oma heute. „Ich habe einfach nach vorne geschaut.“
„Ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht, ich habe einfach nach vorne geschaut.“
Deutschland war hart. Drei Familien in einer Flüchtlingsunterkunft. Mein Opa arbeitete tagsüber, meine Oma nachts als Reinigungskraft. Die Integration war nicht einfach. In den Fabriken wurden die Sudetendeutschen als „Zugereiste“ abgestempelt. Die Sprache war die gleiche – und doch klang das Hochdeutsch der Einheimischen anders als der Dialekt, mit dem meine Großeltern aufgewachsen waren. Doch sie arbeiteten. Sparten. Fanden irgendwann eine Wohnung, dann ein Haus.
Eines Tages, als sie bei Zeiss putzte, geriet sie in ein Gespräch. Sie erzählte, dass sie eine Ausbildung zur Bautechnikerin in der Tschechoslowakei abgeschlossen hatte. Der Mann, mit dem sie sprach, konnte nicht glauben, dass sie mit diesem Abschluss für die Firma putzen würde – und stellte sie kurzerhand als technische Zeichnerin ein. Er gab ihr eine Chance. Sie ergriff sie. „Es war selbstverständlich, dass man etwas macht, aber dass ich wieder zeichnen konnte, hat mich glücklich gemacht.“
Was bleibt, wenn man alles verloren hat?
Heute sagt meine Oma: „Heimat ist da, wo du geboren bist. Aber Zuhause ist da, wo du lebst.“
Sie schaut auf ihr Leben zurück. Nicht mit Wehmut. Mit Stolz.
„Dass ich zwei gesunde Kinder habe. Dass meine Ehe gut war. Und dass wir uns immer durchgekämpft haben – das ist für mich das Wichtigste.“
Meine Oma hat immer eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Sie hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, als Frau auf eigenen Beinen zu stehen. Wie schön Liebe sein kann – aber auch, wie unberechenbar das Leben ist. Das Wichtigste, was sie mir beigebracht hat, ist: Niemals aufzugeben und immer für sich selbst zu kämpfen.
Schon als Kind lauschte ich ihren Geschichten. Doch erst später begann ich zu begreifen, was sie wirklich bedeuten und wie viel Mut hinter ihrer Stimme steckt.
Ihre Geschichte ist mehr als ein Einzelschicksal. Sie steht für Tausende Sudetendeutsche, die nach dem Krieg ihre Heimat verloren – und sich eine neue schaffen mussten. Es ist die Geschichte eines Volkes, das aus der Geschichte verschwand. Es ist die Geschichte einer Frau, die nie aufgegeben hat.
Ich denke daran, wenn ich an Friedland vorbeifahre oder von meiner Familie erzähle. Es ist eine Stadt in einem anderen Land. Eine Stadt, die meine Großeltern verlassen mussten. Aber sie haben etwas mitgenommen: ihre Geschichte.
Jeden Donnerstag, wenn ich die Tür zu ihrer Wohnung öffne und den Duft von Orchideen, Kamillentee und Kernseife rieche, weiß ich: