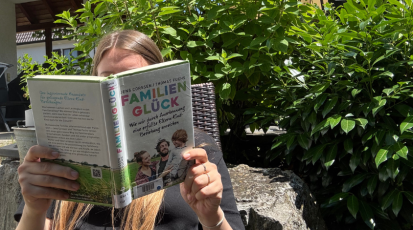Für die Kleinsten ans Limit gehen

Es ist kurz nach eins am Nachmittag. Eigentlich sollten sie zu acht sein. Heute haben sich nur sieben Frauen im sonnengelben Schwesternzimmer um den großen Holztisch versammelt. Für die Spätschicht auf der Neonatologie der Uniklinik Tübingen fehlt wieder jemand. Wieder muss das Team improvisieren.
Mitten unter ihnen: Natalie Hurst. Schulterlange braune Haare, rote Brille, ruhiger Blick. Seit 27 Jahren ist sie Kinderkrankenschwester, seit fünf Jahren arbeitet sie auf dieser Station bei den Allerkleinsten, den Frühchen.
Wie die anderen im Raum trägt Natalie eine dunkelblaue Schwesternkluft und hört aufmerksam zu: Wer übernimmt welches Zimmer, hat sich der Zustand eines kleinen Patienten verschlechtert, verbessert oder ist ein Kind verlegt worden?
Die Schicht beginnt.
Zwei kleine Patienten
Die beiden Frühchen, um die sich Natalie heute kümmern wird, sind vergleichsweise stabil, meint sie, als sie das erste der zahlreichen abgedunkelten Zimmer auf dem langen Krankenhausflur betritt.
Im Raum ist es warm, ungefähr 25 Grad, die Wohlfühltemperatur für Frühchen, die unter normalen Umständen noch im Mutterleib wären. Vier Inkubatoren, von piepsenden Monitoren flankiert, stehen nebeneinander. Kleine Glaskästen mit vielen Schläuchen, die möglichst optimale Bedingungen zum Wachsen und Überleben schaffen.
Natalies kleine Patienten sind zwei von 16 Frühchen auf der Station. Zwei von 10.000 Frühgeborenen mit unter 1.500 Gramm Geburtsgewicht, die in Deutschland jährlich geboren werden.
Die eine, heute drei Wochen alt, kam in der 25. Schwangerschaftswoche mit nur 640 Gramm zur Welt. Ihr Körper ist winzig, das Atmen fällt ihr schwer, laute Geräusche stören sie. Sie wird heute Natalies Sorgenkind bleiben. Die andere ist schon ein bisschen kräftiger, liegt bereits in einem offenen Bettchen. Sie wurde in der 28. Schwangerschaftswoche geboren und bekommt schon weniger Beatmung, doch auch bei ihr zeichnen Monitore ständig Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz auf. Beide Kinder kamen viel zu früh, müssen rund um die Uhr versorgt und beobachtet werden.
Bevor Natalie sich ihre beiden Schützlinge genauer anschaut, desinfiziert sie sich gründlich die Hände, zieht einen gelben Kittel über ihre dunkelblaue Klinikkleidung. Zum Schluss folgen blaue Einmalhandschuhe. Alles muss steril sein. Selbst das Wasser aus dem Waschbecken im Raum ist keimfrei. Die Kleinen sollen sich unter keinen Umständen mit etwas anstecken.
Mit geübten Handbewegungen beginnt Natalie mit der Versorgung: Kabel prüfen, Zugänge kontrollieren, Milch vorbereiten, alle zwei Stunden füttern, Windeln wechseln, Werte dokumentieren. Jeder Handgriff muss sitzen. „Ich gucke auch immer, wo alle Kabel sind, damit ich weiß, wo alles ist, wenn man im Notfall irgendwas braucht“, murmelt Natalie, während sie sich über den Inkubator beugt.
Als Frühgeborene gelten Kinder, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen. Eine reguläre Schwangerschaft dauert etwa 40 Wochen. Besonders kritisch sind Geburten vor der 29. Woche – hier wiegen Babys oft weniger als 1.000 Gramm. In spezialisierten Perinatalzentren mit der höchsten Versorgungsstufe (Level 1) wie der Uniklinik Tübingen werden diese sehr kleinen Frühchen intensivmedizinisch betreut.
Dank medizinischer Fortschritte haben sich die Überlebenschancen dieser Kinder in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Dennoch besteht ein Risiko für langfristige körperliche oder geistige Beeinträchtigungen.
Kleine Erfolgserlebnisse und große Trauer
„Man braucht für alles immer ein bisschen Geduld bei den Frühchen“, sagt Natalie mit einem breiten Lächeln im Gesicht, während die Größere der beiden erstmals ganz langsam die ersten 3 Milliliter Milch selbst trinkt. Schlückchen für Schlückchen - ein echter Kraftakt. Natalie wirkt stolz.
Auf dem Gang trifft die Krankenschwester eine Kollegin. Ein kurzer Blick reicht, und beide wissen: Es geht um das Frühchen aus der letzten Schicht. Es hat es nicht geschafft. Ein kurzer Austausch, traurige Gesichter – dann müssen sie weiter. Solche schmerzlichen Rückschläge gehören zum Alltag und trotzdem belasten sie.
Zwischen Punkten und Piepsen
Alles an den beiden Frühchen wirkt winzig klein. Natalie ist gerade dabei, sich um die stabilere ihrer Schützlinge zu kümmern. Hochkonzentriert und auf das Milligramm genau misst und wiegt sie die winzige Mahlzeit für das kleine Frühchen ab. Mit ruhigen Bewegungen beginnt sie, die Kleine über die Magensonde zu versorgen. Dabei überprüft sie immer wieder vorsichtig, ob alle Schläuche richtig sitzen.
Plötzlich beginnt auf dem Monitor neben dem Bettchen des anderen Mädchens ein roter Alarm. Die Sauerstoffsättigung fällt, ein Atemaussetzer. Natalie bleibt ruhig, beobachtet. Dann geht beides wieder nach oben.
„Das ist in einem gewissen Rahmen normal. Wenn die Kinder das zu viel haben, ist das immer ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist“, erklärt Natalie. Während ihrer Schicht hat das drei Wochen alte Frühchen einige solcher Atemaussetzer. Für jeden gibt es einen Punkt. Zu viele, findet Natalie. Eine Infektion? Sie informiert die Ärztin, die im Laufe der Schicht vorbeischauen wird.

Neben der Verantwortung für zwei winzige Patienten trägt Natalie auch das Kreißsaaltelefon in der Tasche. Es könnte jederzeit klingeln, wenn es im Kreißsaal bei einer Geburt zu einer kritischen Situation kommt. Dann muss die Krankenschwester auf Abruf parat sein, sofort.
Im Arbeitsalltag kann sich Natalie für ihre kleinen Patienten und die Sorgen der Eltern häufig nicht so viel Zeit nehmen, wie sie es gerne möchte. „Das ist, glaube ich, das, was auf Dauer mürbe macht und warum viele aufhören. Die Leute machen an sich ihren Job gerne, wenn sie ihn so machen können, dass sie denken, dass es gut ist“. Sie hält kurz inne und überlegt. „Deswegen glaube ich, klar, ist Bezahlung auch ein Punkt, aber wenn Leute aufhören, ist es eigentlich selten wegen der Bezahlung, sondern weil sie einfach sagen, so das kann ich jetzt nicht mehr“, sagt Natalie nachdenklich.
Wo liegt die Belastungsgrenze?
Kurze Pause, eigentlich. Im Schwesternzimmer setzt sich Natalie seit Beginn der Schicht das erste Mal hin und packt ihre Brotdose aus. Richtig abschalten geht auch hier nicht. Auf einem großen Monitor werden die Werte aller Frühchen auf der Station übertragen. Das Piepsen ist auch hier zu hören.
Als es bei einem der Frühchen beginnt, konstant zu piepsen und eine Kollegin Unterstützung braucht, eilt Natalie sofort zur Hilfe. Die Pause ist erst einmal vorbei. Zeit sie nachzuholen, bleibt nicht.
Dauernd auf den Beinen sein, sich konzentrieren, analysieren, beobachten. All das gehört zu Natalies Beruf. Sie gibt zu, dass das enorm fordernd ist und es auch mal Zeiten gegeben hat, in denen sie darüber nachgedacht hat, etwas anderes zu machen. Die Begeisterung für ihren Beruf ist ihr jedoch im Umgang mit ihren kleinen Patienten anzusehen. “Ich liebe die Pflege, weil man individuell mit einem Menschen so die Zeit gestalten kann, dass er wieder gesund wird. Das ist unheimlich wertvoll, wenn man das miterleben kann“, erzählt Natalie mit einem Lächeln im Gesicht.
Dass sie dieses Arbeitstempo bis zum Renteneintritt halten kann, glaubt sie dennoch nicht. „Also ich kann mir das schon die nächsten Jahre gut vorstellen, aber wenn ich jetzt die Leute sehe, die kurz vor der Rente sind, das ist schon echt richtig anstrengend.“
Sie würde sich deshalb auf der Station mehr Entlastung wünschen. Einen Kollegen oder eine Kollegin, die eine Art „Außendienst“ übernimmt und immer zur Stelle ist, wo es gerade brennt. „Dass man jemand hat, der „außen rum“ ist, jemand der helfen kann, der keine Patienten hat, das wäre gut, aber ich glaube, da sind wir nicht“, so Natalie.
In den vergangenen fünf Jahren hat sich in rund 60 % der Perinatalzentren der Personalmangel auf neonatologischen Intensivstationen verschärft. Die Zahl der eingehenden Bewerbungen ist gesunken, die Personalfluktuation hoch: Allein im Jahr 2022 verließ etwa jede zehnte Pflegekraft diesen Bereich.
Drei Viertel der Zentren rechnen in den kommenden Jahren mit Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Auch die generalistische Pflegeausbildung trägt dazu bei, dass weniger spezialisierte Kinderkrankenpfleger*innen nachrücken.
Quelle: Deutsches Krankenhausinstitut
Immer auf Abruf
Natalie wirkt angestrengt und erschöpft, als sie am Ende der Schicht Atemaussetzer, Sauerstoffwerte und den allgemeinen Zustand der Kinder protokolliert. Auch die Eltern waren da – Kuscheln hilft beim Stabilisieren. Die Ärztin hat Entwarnung gegeben, das Sorgenkind scheint keine Infektion zu haben.
Es ist kurz nach neun. Natalie übergibt an die Nachtschwester, verabschiedet sich von den Kolleginnen, macht sich auf den Weg ins Schwesternzimmer - da klingelt es doch noch: das Kreißsaaltelefon.
Ein Notfall, das Baby ist zu groß für eine natürliche Geburt. Auch das ein Risikofaktor, erklärt Natalie im Laufschritt. Statt in den Feierabend geht es eilig rüber zum Kreißsaal.
Hinter einer massiven Metalltür, die durch einen Bewegungsmelder fast geräuschlos zur Seite gleitet, befindet sich ein Raum mit vier kleinen Wärmebettchen. „Die sind für Notfälle“, sagt Natalie und wirft einen Blick durch die zwei Bullaugen am anderen Ende des Raumes, die einen direkten Blick in den Geburtsraum ermöglichen. Mehrere Ärzte und ihre Assistent*innen beugen sich über die werdende Mutter.
Die Atmosphäre in dem kleinen Vorraum ist angespannt. Leises Geflüster. Ein paar Minuten später ist es so weit: lautes Weinen. Die Türen mit den Bullaugen öffnen sich. Das Neugeborene, das im Vergleich zu den kleinen Frühchen nebenan riesig erscheint, wird kurz untersucht und gewogen: 4.630 Gramm schwer. Alles ist in Ordnung.
Natalie beugt sich über den Kleinen, lächelt breit und wünscht ihm einen guten Start ins Leben. Der Notfalleinsatz ist geschafft. Jetzt, um halb zehn, ist endlich Feierabend. Zeit zum Durchatmen, zumindest für den Moment. Schon in der nächsten Schicht wird Natalie wieder bei den Allerkleinsten gebraucht.