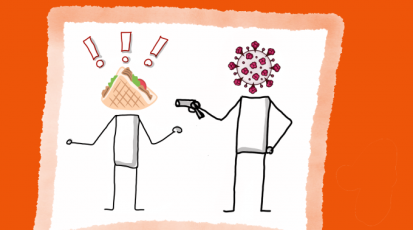„Jugendkulturen sind wichtige Identitätswerkstätten für Jugendliche.“
„Ich bin irgendwie anders“

Es ist Sommer im Jahr 2017. In einem Park in München Pasing hat sich eine Gruppe von Jugendlichen bei ein paar Holzbänken etwas abseits eines leeren Spielplatzes neben einem kleinen Bach versammelt, unter ihnen sind auch Nico und ich. Wir sind Teil der Emo-, Punk- und Metal-Szene. Von Weitem erkennt man schon die vielen bunten Frisuren: Grün, türkis-blau, knallpink oder direkt der komplette Regenbogen, es ist alles dabei. Manche haben einen Irokesenschnitt, andere die klassische Emo-Frisur. Im Gegensatz zu den bunten Haaren ist die Kleidung größtenteils schwarz. Viele tragen dabei ein für die Szene übliches Outfit: ein Bandshirt, eine enge, zerrissene Hose und dazu eine Menge Accessoires, wie Ketten, Nietenarmbänder und Choker. Die Musik aus der Bluetooth-Box, die Gespräche und das Gelächter der Gruppe übertönen das Plätschern des Bachs. Aus der Box dröhnt das Lied „Endlich normale Leute“ von der Band Trailerpark. Nico und ein paar andere singen laut mit, während sie Arm in Arm zu dem Beat schaukeln.
Ich bin seit Ende 2017 nicht mehr in der sogenannten Szene. Nico hingegen ist immer noch ein Teil davon. Jugendkultur gibt es schon seit Jahrzehnten. Sie teilt sich in viele verschiedene Subkulturen auf, auch Szenen genannt. Meistens stammen sie von einem Musikgenre ab und sind somit eng mit Musik verbunden. „Nach wie vor liefern Jugendkulturen für viele Jugendliche den Soundtrack zum Leben. Ein Großteil der Musik, die Jugendliche hören, entstammt Jugend- und Subkulturen“, erklärt Klaus Farin, ein Schriftsteller und Gründer des Archivs der Jugendkulturen. Ein Beispiel dafür ist unter anderem die Emo-, Punk- und Metal-Szene, zu der Nico gehört. Zusätzlich zu der Musik kommen ein kreativer und außergewöhnlicher Modestil, ausgefallene, bunte Frisuren und auch ein gewisser Lifestyle hinzu.
Alles, aber bloß nicht Mainstream, darum geht es hauptsächlich in dieser Szene. Sie wollen auffallen und gegen die Norm der Gesellschaft rebellieren, denn sie selbst fühlen sich dort fehl am Platz. „Ich habe ziemlich früh gemerkt: Okay, ich bin irgendwie anders. Ich funktioniere nicht so in dieser Gesellschaft und mit den Menschen“, erzählt Nico rückblickend. Nico ist Punk. In der Szene ist er auch unter dem Spitznamen „Keks“ bekannt. Er trägt einen Irokesenschnitt mit hellblau gefärbten Haaren und eine Kutte, das ist eine Jeansweste, die mit Nieten und Patches individuell gestaltet und oft von Punks getragen wird. Als er 15 Jahre alt ist, stößt er in der Schule auf Leute, mit denen er sich versteht. Sie nehmen ihn mit zu ihren Freunden und so landet er in der Szene. Jetzt, sechs Jahre später, ist Nico 21 Jahre alt und kann sich ein Leben außerhalb der Szene nicht mehr vorstellen. „Ich glaube, irgendwann verliert man so ein bisschen den Bezug, wenn man da zu krass drin ist. Man lernt nicht mehr wirklich, mit der normalen Welt umzugehen“, erklärt er lachend.
Er hat vorher schon von Menschen gehört, die sich anders kleiden und einfach nichts mit der Gesellschaft und deren Erwartungen an das Leben anfangen können, so wie er. Jetzt hat er Menschen gefunden, die ihn verstehen und seine Interessen sowie Ansichten teilen. Das habe ihm immens geholfen, denn am Anfang habe er nicht gewusst, was er wirklich im Leben will oder wer er überhaupt ist. „Die Szene hat mir schon zu großen Teilen dabei geholfen, mich selbst mehr zu mögen und zu verstehen“, gibt er zu. Auch Klaus Farin sagt: „Jugendkulturen sind wichtige Identitätswerkstätten für Jugendliche, in denen diese auch, wenn sie sich aktiv engagieren, eine Menge Kompetenzen lernen.“ In der Szene gehe es außerdem besonders darum, sich selbst auszudrücken und so zu sein, wie man ist.
Lifestyle und Gemeinschaft
Nico trifft sich fast jeden Tag mit der Gruppe. Es gibt ein paar feste Plätze, an denen sie zusammenkommen. Das sind meist öffentliche Orte, besonders Grünanlagen sind beliebt. Als Nico am Platz ankommt, sind schon ein paar Leute da. Während er auf sie zugeht, hört er immer deutlicher Musik, die aus einer Bluetooth-Box kommt. Mittlerweile haben die anderen ihn bemerkt und begrüßen ihn herzlich. Er setzt sich zu ihnen und ist schnell in ein Gespräch vertieft. Im Laufe des Tages kommen noch weitere dazu, meist sind es insgesamt 15 bis 20 Leute. Sie unterhalten sich, hören Musik und trinken Alkohol. Nico gesteht, dass Alkoholkonsum auch ein Teil der Szene ist und zum Lifestyle dazugehört. „Ich glaube, dass es zum großen Teil tatsächlich mit psychischen Problemen zusammenhängt. Man versucht, irgendwas zu betäuben, irgendwie seine Laune aufzubessern“, sagt er. Alkoholkonsum stehe aber nicht im Mittelpunkt eines Szenentreffens, sondern der Austausch untereinander über gemeinsame Interessen und persönliche Probleme, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen.
Laut Nico sind psychische Erkrankungen sehr präsent in der Szene. Damit gingen sie aber offen um. Stereotype, wie „Emos sind depressiv“, träfen oft zu. Das komme auch daher, dass sich diese Menschen in unserer Gesellschaft unwohl fühlen. Der offene Umgang mit psychischen Leiden und der Zusammenhalt in der Szene geben Nico in schwierigen Zeiten Komfort. Es herrscht ein gegenseitiges Verständnis. Die Szene ist eine Gemeinschaft. Hier finden viele so etwas wie ein Zuhause oder eine Familie, die manche von ihnen außerhalb der Szene so nicht haben. Auch Nico hatte es nicht immer einfach in seiner Familie. Er wollte einen Weg im Leben gehen, der nicht den Vorstellungen seiner Eltern entsprach.
„Man verliert sich schon so ein bisschen in der Szene, wo man verstanden wird, wo man Sachen einfach sagen kann, wo das angenommen wird. Das beobachte ich auch bei vielen anderen in der Szene, dass sie in der normalen Welt gar nicht mehr so zurechtkommen, also im Thema Beruf finden, dort wirklich auch arbeiten oder zur Schule gehen“, erzählt Nico und meint, dass es ihm vor ein paar Jahren ähnlich erging. Er rutscht immer tiefer in die Szene und in diesen „Ich mach, worauf ich Bock hab“-Lifestyle ab, bis er anfängt, die Schule zu meiden. Seine Eltern sind mit seinem Lebensstil nicht einverstanden. Sie werfen ihn zweimal von zuhause raus, sodass er für eine Weile obdachlos ist. Mit der Zeit erkennt er jedoch, dass es so nicht weitergehen kann. Er spricht sich mit seinen Eltern aus und verbessert sein Verhältnis zu ihnen. Sie akzeptieren jetzt auch den Weg, den er für sich ausgesucht hat. Er will unabhängig von der Gesellschaft leben, sich keine Sorgen um einen Beruf oder Geld machen. Er hat für sich beschlossen, dass er einfach nicht in die Allgemeinheit und deren Wertevorstellungen passt. Er bereut seinen Weg nicht. „Ich habe das erreicht, was ich wollte, nämlich frei zu sein, und das ist in meinen Augen das Wichtigste.“