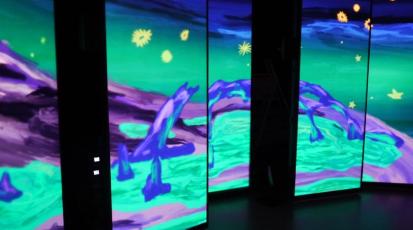"Nicht mit angezogener Handbremse"

Wenn dein Leben verfilmt würde, wer sollte dich spielen?
Qual der Wahl…Jude Law.
Ist er dein Vorbild?
Nein, ich habe kein Vorbild. Es gibt tolle Schauspieler, aber keinen, nach dem ich strebe.
Was ist Schauspielerei für dich in einem Wort?
Leidenschaft.
Wann hast du denn diese Leidenschaft entdeckt?
Ich wollte schon als Kind auf die Bühne, wollte mich darstellen und in verschiedene Rollen schlüpfen. Ich habe nie was anderes im Kopf gehabt.
Und dann bist du mit 17 Jahren von Bern nach New York gezogen, um am renommierten Lee Strasberg Institute zu studieren. Wie kam es dazu?
Durch ein ganz normales Bewerbungsverfahren. Ich hatte davor ein Austauschjahr in Amerika gemacht und wollte auf jeden Fall in den USA bleiben. Die darstellende Kunst wird da einfach viel mehr gefördert als dort, wo ich aufgewachsen bin in der Schweiz.
Viele Eltern sind ja nicht unbedingt begeistert, wenn das Kind sich für eine solch unsichere Karriere entscheidet.
Meine Mutter hat das immer unterstützt und mein Vater hatte zwar irgendwann mal gesagt, ich solle erst etwas Anständiges lernen, aber er hat dann doch eingesehen, dass mein Wille zu stark ist.
„David alleine in New York“ – schon ein großer Schritt mit 17, oder?
Im Nachhinein ist das schon krass, dass ich das gemacht habe und dass meine Eltern mich haben gehen lassen. Irgendwie hat das aber gut funktioniert. Ich glaube, ich habe immer so einen inneren Schutzschild um mich herum gehabt, der mich vor den schlechten Dingen bewahrt hat, die einem in so einer Stadt widerfahren können.
Deinen Schauspielabschluss hast du dann 2001 in Freiburg gemacht. Wie sah es zu Beginn finanziell aus? Man hört ja oft, dass auch Schauspieler, die heute sehr berühmt sind, sich anfänglich mit kleinen Jobs über Wasser halten mussten.
Direkt nach der Schauspielschule hatte ich Angebote an drei Theatern, wo ich hingehen konnte. Natürlich, da verdienst du als Anfänger sehr wenig Geld, damals noch deutlich weniger als heute. Aber es ist komisch, mit 20 oder 22 war ich einfach glücklich, das machen zu können, was ich machen wollte. Dass ich nicht viel verdiente, war tatsächlich nebensächlich. Heute ist es für mich unvorstellbar, dass ich mit diesem Betrag überleben konnte.
Es folgten Engagements unter anderem in Bamberg, Bonn und Köln. Warum bist du in Deutschland geblieben und nicht zum Spielen in deine Heimat, die Schweiz, zurückgegangen?
Ich wollte immer weg aus der Schweiz. Das ist mir dort ein bisschen zu sortiert, zu geordnet, das Denken der Menschen zu klein.
Du bist recht viel unterwegs hier in Deutschland, wie vereinbart sich das mit dem Privatleben?
Man muss sich organisieren. Um eine Beziehung am Leben zu erhalten, muss man, wenn man eine kleine Lücke hat, eben bereit sein, fünf Stunden zu fahren, um nur einen Tag da zu sein.
Ans Junge Theater Bonn bist du einige Jahre nach deinem Engagement als Schauspiellehrer zurückgekehrt. Warum?
Es gab einen Sommer, in dem ich keine Engagements hatte und da hatte mich das Junge Theater für einen Workshop angefragt. Ich habe gedacht „Oh Gott, das kann ich bestimmt nicht“, aber irgendwie habe ich diese drei Wochen ganz gut hingekriegt und das dann ein paar Jahre lang neben meiner normalen Arbeit als Schauspieler gemacht. Und tatsächlich habe ich durch diese Arbeit ganz viel über mich selbst und mein Spiel gelernt: einfach loslassen und freimachen.
Was ist für dich das Wichtigste, das man seinen Schülern mitgeben kann?
Selbstvertrauen und dass sie mutig sein müssen.
Momentan bist du im Contra-Kreis-Theater in Bonn in „Die Wahrheit über Dinner for One“ zu sehen. Wenn man sich deine bisherige Theaterkarriere anschaut, führen die Komödien – wie z.B. „Ein Halbgott in Nöten“, „Charleys Tante“ oder „Achtung, Deutsch“ – auch recht deutlich das Feld an. Spielst du dieses Genre am liebsten?
Ich spiele es sehr gerne, sagen wir es mal so. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren so ergeben, dass ich von einer Komödie zur anderen gereicht wurde und da kann ich mich nicht drüber beklagen. Aber ich würde mir für 2020 sehr wünschen, mal wieder was schön Dramatisches zu spielen.
Dramatisch war ja zum Beispiel „Montgomery Clift“, den du 2015 und 2016 in Bad Godesberg und Köln verkörpert hast. Ein doch recht düsterer Part, die Geschichte wird oftmals als „der langsamste Suizid Hollywoods“ betitelt. Wie bereitet man sich auf so etwas vor?
Viel Recherche. In sich selbst hineinschauen, wo das eigene Innenleben mit dem der Figur andockt. Und auch hier mutig genug sein, das Leid, das er erlebt hat, für den Moment zuzulassen und nicht mit angezogener Handbremse zu spielen. Aber das war sehr anstrengend, da 90 Minuten lang alleine auf der Bühne zu sein und solche Gefühle zu erleben.
Wenn du zwei Jahre lang immer wieder das Gleiche spielst – in „Charleys Tante“ hast du insgesamt sogar drei Engagements lang auf der Bühne gestanden – wie geht man an so etwas Altbekanntes immer wieder neu heran?
Da muss man sich selber herausfordern, es jeden Abend neu zu erleben und neu zu denken, denn die Figur weiß ja nicht, was passiert an diesem Abend und der Zuschauer weiß es im besten Fall auch noch nicht. Und ich sage mir immer, die haben ja genau so viel bezahlt wie die, die letzte Woche da waren, und deswegen kriegen sie genauso eine frische Vorstellung. Es hat aber ganz gut getan, dass ich das an vier verschiedenen, Theatern gespielt habe und die Besetzung sich jedes Mal verändert hat. Dann guckst du in andere Augen und hörst andere Menschen den Text sagen und dann bleibt das ein bisschen lebendig. Aber ich habe es über 200-mal gespielt und ich möchte es nie wieder spielen. (lacht)
Deine bisherigen Filme haben dir Abwechslung zu den vielen Komödien geboten. Dein erstes großes Projekt, „Invasion“ von Dito Tsintsadze, wurde beim World Film Festival in Montréal 2012 mit dem „Special Grand Prix of the Jury“ ausgezeichnet und du für den Förderpreis „Neues Deutsches Kino Schauspiel“ nominiert. Aber woher kam der Sprung von den „Brettern, die die Welt bedeuten“ vor die Kamera?
Damals hab ich völlig ahnungslos eine E-Mail von meinem Agenten bekommen, dass ein Regisseur mich für eine Filmrolle kennenlernen möchte. Aber da das schon so oft der Fall gewesen war und es nie geklappt hatte, habe ich mir keine großen Gedanken drüber gemacht und habe sogar noch gesagt: „Aber ich muss erstmal in Urlaub“. Sie haben tatsächlich auf mich gewartet – und nach dem Casting hatte ich noch am selben Tag die Zusage. Das werde ich nie vergessen.

Wenn die meisten Castings zu Absagen führen, wie macht man dann trotzdem weiter?
Je nachdem wie groß oder wichtig die Rollen waren. Es gibt Rollen, die dein Leben verändern könnten, weil du dadurch entweder sehr viel Geld verdienst oder in eine andere Stadt ziehst oder tatsächlich berühmt wirst. Das nagt dann schon sehr, wenn man diese Parts nicht bekommt.
Zum Beispiel?
„Harry Potter“. In Hamburg. Ich war unter den letzten fünf. Das Casting hat vier Monate gedauert, ich hatte ein wirklich gutes Gefühl und dann hat es nicht geklappt. Diese Rolle hätte mein Leben sehr verändert. Aber – hat es halt nicht.
Deine Karriere hat dich neben dem Kino auch zur Werbung und zum Fernsehen geführt, kürzlich zum Beispiel zur KiKA-Serie „Ein Fall für die Erdmännchen“. Stehst du lieber vor der Kamera oder auf der Bühne?
Die Frage ist schwierig zu beantworten. Die Rolle muss stimmen, das Stück, bzw. der Film, das ist mir wichtiger als der tatsächliche Ort. Um längerfristig engagiert zu sein, ist immer Theater besser, beim Film ist halt alles sehr schnell wieder vorbei. Das Budget wird immer kürzer und die Drehtage knapper. Aber finanziell ist natürlich Film besser.
Außerdem bist du im letzten Jahr die Autoren gegangen. Erste Erfahrungen hattest du 2012 bereits mit deinem Part in Hella von Sinnens „Des Wahnsinns fette Beute“ gesammelt. In deinem Roman „Oliver und Ich“ geht es nun um einen jungen Mann, der mit sich selbst und der Welt nicht im Reinen ist und Zuflucht in der Welt der alten Hollywood-Filme sucht. Dort entdeckt er dann Parallelen zum Leben eines jung verstorbenen Schauspielers und überdenkt im Zuge dessen auch sein eigenes. Woher kam die Inspiration zu dieser Story?
Oh Gott, die ist mir einfach eingefallen – aber erst mal als Film oder Theaterstück. Da habe ich aber beim Schreiben keinen Zugang gefunden und es dann als Roman versucht. Zwei Engagements lang habe ich das Ganze in meiner Freizeit dann geschrieben.
Hättest du denn auch Ambitionen in Richtung Drehbuchautor oder Regisseur?
Regie könnte ich mir schon vorstellen, ja doch.
Da hast du ja am Jungen Theater schon etwas Erfahrung gesammelt.
Richtig. Aber ich glaube, dass professionelle Schauspieler deutlich anstrengender sind als so nette Jugendliche wie damals.
Schaust du auf deine bisherige Karriere zurück, was war dein persönlicher Höhepunkt?
„Invasion“!
Warum?
Es war einfach ein toller Film mit unglaublich tollen Schauspielern und Dreharbeiten. Und dann natürlich auch der Besuch der Filmfestivals.
Der Film war ja auch recht erfolgreich. Wagen wir jetzt einen Blick in die Zukunft, was möchtest du gerne noch erreichen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mich weiterhin immer davon ernähren kann, dass ich genug Geld verdiene, um glücklich und zufrieden zu sein und dass ich gute Rollen spiele und mit tollen Leuten arbeite. Aber natürlich auch, dass ich stets weiterkomme und bekannter werde.
Wir haben eingangs drüber geredet, wer dich spielen soll – Jude Law – welche Rolle würdest du denn unbedingt einmal haben wollen?
Dorian Grey. Das ist eine Roman-Figur von Oscar Wilde und das wäre eine tolle Rolle.
Weil?
Es ist düster, hat Tiefe und die Figur ist so böse, das würde Spaß machen.
Mal keine Komödie, sondern richtig böse.
(lacht) Genau!
Vielen Dank für das Interview!