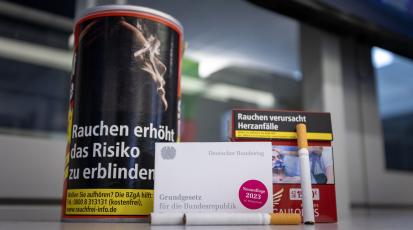Der American Dream: Vom Tellerwäscher zur Abschiebung

Amerika Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ein Land, in dem man es mit harter Arbeit zu allem schaffen kann. Seit Jahrhunderten verschlägt es Migrant*innen aus aller Welt genau hier hin, getrieben von der Hoffnung sich und ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.
Doch diese Vorstellung ist ein längst überholtes Märchen aus vergangenen Zeiten. Beim Blick in die sozialen Medien fällt einem schnell der Mann mit dem Slogan "Make Amerika great again" auf, der verspricht, unzählige Personen mit Migrationshintergrund zurück in ihre Herkunftsländer zu deportieren. Donald Trumps Anhängerschaft, die ihn geradezu götzengleich zu verehren scheint, jubelt daraufhin lauthals. Ein gewagter Ansatz, wenn man bedenkt, dass alle Amerikaner*innen, mit Ausnahme der Ureinwohner*innen, die in Reservate zurückgedrängt wurden, eine Migrationsgeschichte haben. Doch dieser Fakt scheint Trump und seiner Anhängerschaft egal zu sein.
Dieses Amerika wirkt befremdlich, ein Schatten seiner einstigen Rolle als Zufluchtslicht für Migrant*innen. Im Folgenden kommen Betroffene von Trumps Migrationspolitik zu Wort, außerdem wird versucht zu verstehen, woher diese fremdenfeindliche Haltung in einem Land wie Amerika kommt und warum sie auf fruchtbaren Boden fällt.
Trumps Feldzug gegen Migrant*innen
Eine besonders bedenkliche Maßnahme ist Trumps Versuch, gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten vorzugehen, indem er einen Erlass verabschiedete, der das 14. Amendment untergräbt, jenes Gesetz also, das besagt, dass alle auf US-amerikanischem Boden geborenen Personen automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten. Diese Maßnahme wird zur Zeit von mehreren Gerichten als verfassungswidrig angesehen und wurde daher vorerst gestoppt. Das veranlasst Trump jedoch nicht dazu zurückzurudern, stattdessen wettert er auf seinem Onlinedienst Truth Social gegen die Richter des Supreme Courts, wie ein Trotzkind im Oval Office. Statt mit Einsicht reagiert er mit Eskalation, wenn man ihm Grenzen aufzeigt. Mit der Executive Order zum nationalen Notstand an der Südgrenze verschaffte sich Trump weitreichende Befugnisse, etwa zur Nutzung von Militärressourcen für Massenabschiebungen und den Bau von Grenzanlagen. Seit Januar 2025 sind auch bislang geschützte Orte wie Schulen, Kirchen oder Krankenhäuser nicht mehr vor Zugriffen durch die United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), die größte Polizei- und Zollbehörde für innere Sicherheit, sicher. Zusätzlich unterzeichnete Trump den „Laken Riley Act“, der Inhaftierungen bei geringfügigen Vergehen ohne Kaution ermöglicht.
Für sie ist es mehr als nur Politik
Stephanie Gonzalez ist eine Betroffene, die sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte zu teilen. Als Stephanies Eltern, die ursprünglich aus Kolumbien stammen, zu einem Routinecheck der Einwanderungsbehörde gingen, der erste, nachdem Trump seine zweite Amtszeit angetreten hatte, seien sie in Ketten gelegt worden, die von ihren Handgelenken bis zu ihren Füßen reichten und stundenlang getrennt voneinander verhört worden. Als sich ihre Mutter beschwerte, dass ihr die Ketten nach mehreren Stunden Schmerzen bereiten würden, habe ihr der Officer nur geraten sich langsamer zu bewegen. Schließlich sei ihre Abschiebung beschlossen worden, ohne dass sich die Beiden hätten verabschieden können. So seien sie nach 35 Jahren von ihrer Familie und allem, was sie sich in Amerika aufgebaut hatten, getrennt und in ein Land abgeschoben worden, zu dem sie jeglichen Bezug verloren hatten. Die Beiden seien nie kriminell auffällig geworden, hätten immer gearbeitet, rechtzeitig Steuern gezahlt und wären von ihrem Umfeld stets als liebevolle Eltern, gute Freunde und angenehme Mitmenschen beschrieben worden. Mit Hilfe einer Gofundme Seite versuche Stephanie nun ihren Eltern zu helfen ihr Leben in Kolumbien wieder aufzubauen.

Amnesty International positioniert sich klar gegen Trump
Amnesty International, eine Organisation die sich weltweit für Menschenrechte einsetzt, verurteilt diese Politik zutiefst.
Maja Liebing, Amerika-Expertin bei Amnesty Interantional ordnet Trump's Politik wie folgt ein:
„Anfang März ordnete die Trump-Regierung die Wiedereröffnung von Haftanstalten in den USA für die Inhaftierung von Familien an. Amnesty International bewertet die Inhaftierung von Menschen allein aufgrund ihres Einwanderungsstatus‘ als willkürlich und als Verstoß gegen das Völkerrecht. Die von Amnesty International dokumentierten Einzelfälle zeigen deutlich, wie sehr die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung auf Rassismus basiert und rechtsstaatliche Prinzipien missachtet.
An der Grenze zu Mexiko ist die Situation dramatisch. Amnesty International musste im Februar feststellen, dass das Recht auf Asyl an der Grenze nicht mehr existiert – was einen Verstoß gegen die nationalen und internationalen Menschenrechtsverpflichtungen der USA darstellt. Aktuell sind zehntausende Menschen in Mexiko gestrandet und haben keine Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Zusätzlich haben die USA das US-amerikanische Flüchtlingsaufnahmeprogramm abgeschafft und Gelder für humanitäre Organisationen, die an der Grenze arbeiten, eingefroren.“
Geschichte des Misstrauens
Der Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte, Michael Hochgeschwender, klärt mich darüber auf, dass die romantisierte Annahme, die Vereinigten Staaten wären immer so offen für Migration gewesen, grundsätzlich falsch ist. Migration verliefe in Wellen, ebenso wie Fremdenfeindlichkeit und rassistische Bewegungen, die sich gegen bestimmte Gruppen richteten. Ein Beispiel dafür ist die American Protective Association, die sich etwa gegen Juden, Katholiken und auch Hispanics richtete. Ein weiteres historisches Spannungsfeld ist der Frieden von Guadalupe Hidalgo, durch den viele Lateinamerikaner*innen US-Staatsbürger*innen wurden, besonders im Südwesten führte dies zu Konflikten. 1943 folgten in Los Angeles tagelange Ausschreitungen, bei denen US-Streitkräfte Lateinamerikaner*innen attackierten, unterstützt oder geduldet von der Polizei. Solche Übergriffe sind Ausdruck tief sitzender Spannungen zwischen lateinamerikanischen Zugewanderten und rassistisch oder fremdenfeindlich gesinnten Teilen der Mehrheitsgesellschaft. In Zeiten wirtschaftlicher Not oder Arbeitskräftemangels jedoch, so Hochgeschwender, wurden diese Spannungen oft ignoriert. So wurde etwa in den 1950er-Jahren das Bracero-Programm reaktiviert, um lateinamerikanische Arbeitskräfte während des Koreakriegs für die Rüstungsindustrie zu gewinnen. 1964 wurde das Programm zwar eingestellt, doch viele der angeworbenen Arbeitskräfte blieben, auch weil es kein zentrales Meldesystem gab. Das führte zu einem Gefühl des Kontrollverlusts über die südwestliche Grenze und gab migrationskritische Strömungen neues Feuer.
Trumps Erfolgsgeschichte
Die Ethnologin Giovanna Campani sagt hierzu, dass sich in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten selbst traditionell links eingestellte Wahlberechtigte zunehmend nach rechts orientieren, getrieben von Sorgen über Einwanderung sowie dem wachsenden Wettbewerb um knappe Ressourcen und Arbeitsplätze. In diesen aufgewühlten Zeiten betreten oftmals charismatische Persönlichkeiten die Weltbühne, die einfache Lösungen zu komplexen gesellschaftlichen Problemen bieten.
Trump legt den Finger in die richtige Wunde, seinen politischen Aufstieg verdankt er seiner migrationsfeindlichen Rhetorik und mit der gezielten Kriminalisierung eben dieser Personengruppen. Zudem weiß Trump genau, wie er die sozialen Medien für seinen Wahlkampf instrumentalisieren muss und normalisiert zunehmend ebendiese Rhetorik für seine Followerschaft.
Die Folgen von Trumps Kurs
In Trumps letzter Legislaturperiode führten seine aggressive Rhetorik und Politik zu einem Klima der Angst, das viele Migrant*innen dazu veranlasste, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Dies äußerte sich beispielsweise darin, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr zur Schule schickten oder medizinische Routineuntersuchungen mieden, aus Angst vor möglichen Abschiebungen.
Diese Stimmung wurde auch im Gespräch mit verschiedenen amerikanischen Staatsbürgerinnen deutlich. Im Folgenden kommen verschiedene Personen zu Wort: Pia, die aus Deutschland nach Amerika migriert ist, sie hat Freunde in beiden politischen Lagern, sowie Luciana und ihre Freundin, zwei in den Vereinigten Staaten arbeitende Latinas, die sich vor einer möglichen Abschiebung unter Donald Trump fürchten.
Was bleibt vom Traum?
Donald Trump hat es uns zu verstehen gegeben was passiert, wenn ein narzisstischer Geschäftsmann, der Deals und sein Ego über Menschen stellt in eine Machtposition kommt. Seine Rhetorik instrumentalisiert bewusst die Ängste der Bevölkerung und kriminalisiert Migrant*innen. Eine widersprüchliche Haltung, bedenkt man, dass die Vereinigten Staaten ein Land mit einer Migrationsgesellschaft sind. Von welchem Amerika er hier wohl spricht, vielleicht von einem Amerika ohne die Trumps? Der Versuch, zwischen "guten" und "schlechten" Migrant*innen zu unterscheiden, ist letztlich nichts anderes als Ausdruck rassistischer Denkweisen. Er tritt als charismatischer „Retter“ Amerikas auf, ohne zu berücksichtigen, dass sich die Welt seit seiner Jugendzeit weiterentwickelt hat. Seine Politik macht migrierte Personen zu Sündenböcken für weitaus komplexere Problematiken und schickt sie in Länder zurück, zu denen sie keinen Bezug mehr haben. Während er und seine kultartige Gefolgschaft sich immer weiter radikalisieren.
Jedoch hat sich Amerika auch von vergangen fremdenfeindlichen Bewegungen erholt, Lady Liberty steht noch, auch wenn der Sturm tobt und wird auch Personen wie Donald Trump überdauern, der selbst ein Kinder von Migranten ist und denkt, er könnte sich den American Dream zu eigen machen. Vielleicht werden die Amerikaner*innen ja bald realisieren, dass man eben doch auf Migration angewiesen ist und wieder in der Lage sein Brücken statt Mauern zu bauen.