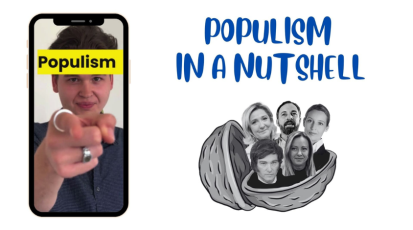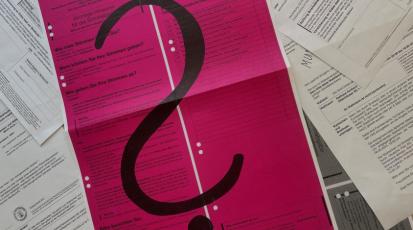„Das Interessante an der Nationalhymne ist, dass es eine Bedeutungsverschiebung und Umkodierungen gibt, die je nach politischem System stattfinden."
Ideologien in Dur und Moll: Der politische Einsatz von Musik

Hinweis
Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema „Wie nutzt die Politik Musik?“.
Außerdem zum Dossier gehören folgende Beiträge:
Video: Musik wird politisch - Links und laut
Podcast: Playlist der Rechten: Wie instrumentalisiert die AfD Musik?
Musik, wir sind ständig von ihr umgeben, im Alltag, in der Werbung, auf Konzerten, doch die Wenigsten machen sich bewusst, wie stark sie uns tatsächlich beeinflusst. Expert*innen sagen, dass Musik unser Kaufverhalten lenken, Emotionen wecken, Erinnerungen aktivieren und sogar das Gefühl von Zugehörigkeit erzeugen kann. Vor allem ihre emotionale Kraft macht Musik auch politisch interessant. Wohl kaum ein anderes Medium schafft es, so schnell einen Sinn für Gemeinschaft zu stiften oder eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, sagt der Historiker Carsten Kretschmann, der an der Universität Stuttgart lehrt.
Kein Wunder also, dass sich auch die Politik dieses Instrumentes bedient. Wie der Musikwissenschaftler Kai Hinrich Müller, tätig an der Hochschule für Musik und Theater Roststock, betont, kann Musik sowohl motivierend und verbindend wirken, als auch missbraucht werden. Um die politischen Absichten eines Songs zu deuten, müsse man den Text, wie auch andere Stücke des Künstlers und seine generellen politischen Äußerungen mit in Betrachtung ziehen, schreibt Hans-Werner Kuhn im Sammelband „Politik in der Kunst- Kunst in der Politik“. Zudem waren es hauptsächlich immer die politischen Ränder, also rechte und linke Szenen, die sich der Wirkung der Musik bedienten, so Kretschmann.
Und bei den Linken?
Befasst man sich mit diesen politischen Rändern, so wird deutlich, dass die politische Linke die Kraft der Musik als Ausdruck ihres Lebensstils und ihrer politischen Ziele sieht, so ein Bericht des Verfassungsschutzes. Wie das nun in der Praxis aussieht und inwieweit Musik die Linken in ihrem Aktivismus bestärkt oder beeinflusst, thematisiert das Video.
Andere Berührungspunkte zwischen linker Politik und Musik sind beispielsweise die Umdichtung des bekannten Kinderliedes „Hejo, spann den Wagen an“. Es wurde seit den 70er Jahren zum Protestlied gegen soziale Missstände und bei den Protesten gegen Rechts zu „Wehrt euch, leistet Widerstand, gegen den Faschismus in unser’m Land!“ umgedichtet wurde. Bezüge zu Musik zeigen sich bei den Linken auch durch die Freundschaftsarmbänder, die Heidi Reichinneks Arm zieren. Sie sind ein verbreitetes Ritual unter Taylor Swift Fans.
Musik und Extremismus
Sowohl linke als auch rechte Musik kann in Extreme abrutschen. Die Forschung befasst sich allerdings noch nicht lange mit Linksextremismus in Verbindung zu Musik. Linksextremistische Musik soll, ebenso wie rechtsextremistische Musik, ideologische Überzeugungen übermitteln und Emotionen wecken. Stücke, wie von dem deutschen Sänger und Schauspieler Ernst Busch, oder Antifa-Rock sind oftmals gewaltverherrlichend gegenüber politischen Gegner*innen und Polizist*innen. Ein weiteres Beispiel dafür ist das Lied „Bullenschweine“ der Band Slime.
Der linksextreme Musikstil reagiert hier auf rechte Hassmusik.
Studien und Fallberichten zufolge verstärkt rechtsextremistische Musik Gewaltfantasien und Tatmotive. Zudem kann man beobachten, dass die extreme Rechte seit den 1990er Jahren gezielt Musik nutzt, um politischen Veranstaltungen einen eventgleichen Charakter zu verleihen und jungen Menschen rechte Ideologien näherzubringen.
Rechtsrock als Einstiegsdroge?
In einem Interview mit dem Journal EXIT berichtet Felix Benneckenstein, ein ehemaliger Neonazi, der auch selbst Musik für die Szene produziert hat, dass er zunächst nur auf rechte Musik gestoßen sei, da ihm die Melodien gefielen. Schnell hörte er immer extremere Lieder und wurde mit rechtsextremistischen Ideologien vertraut. Schließlich produzierte er selbst Lieder und nutzte ganz bewusst die vermittelnde und emotionalisierende Wirkung von Musik, um auch Andere mit rechten Ideologien vertraut zu machen. An seinem Beispiel erkennt man, wie wirkungsvoll die gezielte Nutzung von Musik sein kann. Schließlich wurde er anfangs nur vom Klang und der Ästhetik der Lieder angesprochen. Stück für Stück rutschte er dann ins rechte politische Spektrum. Der Historiker Kretschmann betont, dass eine große Gefahr darin besteht, wenn ein bekanntes Lied mit gleichem Text und gleicher Melodie von einer völlig anderen Gruppierung genutzt wird. Nur die Wenigsten setzen sich mit der Umdeutung und Aneignung der Lieder auseinander. „Wer den alten Kontext nicht kennt, dem wird kaum auffallen, dass da etwas verschoben wurde“, so der Historiker. Dennoch sei der Fall von Felix Benneckenstein wohl eher eine Ausnahme. Es gäbe genügend gute Gründe, die fortgesetzte Rede von der "Einstiegsdroge Musik" zurückzuweisen, ohne die Bedeutung von Musik für die extreme Rechte kleinzureden oder gar zu verharmlosen, so der Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs. Er betont, rechte Musik könne tatsächlich wirken. Das sei allerdings abhängig vom individuellen Zustand und dem soziokulturellen Umfeld.
Im Podcast geht es darum, wie die AfD bekannte Lieder für ihren Wahlkampf nutzt und was die Künstler*innen dazu sagen.
Mehr als nur ein Lied – die Nationalhymne als Spiegel der Geschichte
Wohl kein Beispiel zeigt so deutlich, wie stark der Vergemeintschaftungsaspekt der Musik ist, wie die deutsche Nationalhymne. „Hymnen haben eine Wirkung nach innen, sie zeigen wir sind ein Land und vermitteln eine gewisse Feierlichkeit“, sagt der Musikwissenschaftler Müller.
Der Kern der Hymne, die Hoffmann von Fallersleben Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb, ist ein Sammelwerk der Sehnsuchtsbegriffe der deutschen Nationalbewegung. Die Hymne geht dem Nationalstaat voraus und entfaltet ihre Kraft als Appell so der Historiker Kretschmann. Laut Kretschmann konnte man mit der Hymne bereits ein Selbstverständnis für den Nationalstaat erreichen, bevor dieser überhaupt gegründet wurde."Das Interessante an der Nationalhymne ist, dass es eine Bedeutungsverschiebung und Umkodierungen gibt, die je nach politischem System stattfinden", so der Historiker.
Im Nationalsozialismus bekamen die Hymne, und im Liedtext enthaltende Formulierungen wie „Freiheit“, natürlich eine ganz neue Bedeutung. Der Begriff „Recht“ werde nach NS-Verständnis definiert, so Kretschmann. Die Hymne ist so tief im kollektiven Gedächtnis gespeichert, dass eine neue Hymne zu schreiben, nicht zum Diskussionspunkt wurde. Nach einem Briefwechsel zwischen Bundeskanzler Adenauer und Bundespräsident Heuss wurde entschieden, dass die dritte Strophe zur Nationalhymne werden sollte. Heutzutage singen allenfalls die extremen politischen Ränder die ersten beiden Strophen. Am Beispiel der Nationalhymne sieht man, wie ein Lied Gemeinschaft und Identität stiften kann, aber auch zur Erhaltung diktatorischer Strukturen und antidemokratischer Systeme beitragen kann, indem es Ideologien verbreitet. Auch die Deutungen und Anlässe, an denen die Hymne gespielt wird, zeigen das breite Spektrum auf, das Musik schaffen kann. Für die einen ist es ein harmloses Zeichen des Nationalstolzes, für die anderen ist es eine Bestärkung ihrer radikalen politischen Ansichten.