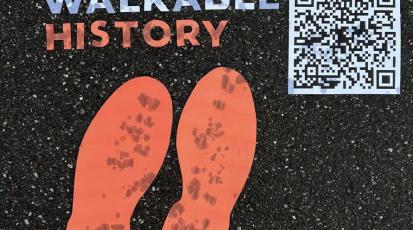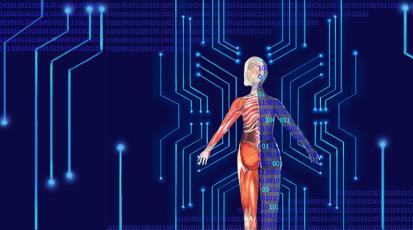Zwischen Stall und Siegel – wie wir Nutztierhaltung neu denken müssen

Hinweis
Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema ,,Nutztierhaltung''.
Dazu gehört auch:
Frei von Hunger und Durst. Frei von Schmerzen und Krankheiten. Frei von Angst, Stress und gesundheitlichen Beschwerden sowie die Freiheit, sich artgemäß verhalten zu können. So beschreibt das Konzept der Fünf Freiheiten, entwickelt 1979 vom britischen Farm Animal Welfare Council, was tiergerechte Haltung ausmacht. Doch wie sieht die Realität in Deutschlands Ställen aus? Längst ist klar, dass die Nutztierhaltung oft nicht so gerecht und frei ist, wie sie sein sollte. Hinzu kommt, dass der heutige Weg zu mehr Tierwohl - ein Dschungel an Gütesiegeln - eher Verwirrung stiftet, als für Orientierung zu sorgen. Die Nutztierhaltung der Zukunft muss transparenter und einheitlicher werden. Doch wo kann man ansetzen? Und: Welche Zukunft wollen wir Verbrauchenden für die Nutztiere?
Was ist tiergerecht?
Tiergerechtigkeit bedeutet, Nutztieren wie Schweinen und Rindern in den Punkten Haltung, Pflege und Fütterung gerecht zu begegnen, sodass sich die Tiere normal verhalten können. Die konventionelle Tierhaltung kann diesem Anspruch kaum gerecht werden. Hier geht es um Leistung und Effizienz - mit gravierenden Folgen für die Tiere: Stress, Krankheit und Quälerei stehen an der Tagesordnung. Denn im Zuchtverfahren werden nur Tiere vermehrt, die schnellen Ertrag liefern. So beschert es der Industrie den größten Profit. Doch nicht nur das: Auch den Ställen mangelt es gut und gerne an Gerechtigkeit. Dunkelheit, Enge und Monotonie ist für viele Nutztiere Normalität. Und die Politik? Die duldet, was für viele längst Tierquälerei ist – vor allem in der Fleischindustrie.
Die Sache mit den Ringelschwänzen
Ein besonders erschreckendes Beispiel für Tierquälerei ist das routinemäßige Kürzen der Ringelschwänze bei Schweinen. Obwohl 1991 von der EU verboten, wird es in Deutschland bei rund 95 Prozent der Tiere weiterhin praktiziert. Dabei wird den Ferkeln der Schwanz nur wenige Tage nach der Geburt ohne Betäubung amputiert. Warum? Schweine beißen einander die Ringelschwänze ab, wenn ihnen langweilig oder unwohl ist - beides Folgen nicht tiergerechter Haltung. Im Umkehrschluss ist ein intakter Ringelschwanz also eigentlich ein Zeichen gesunder Tiere. Die Ironie: Statt die Ursache zu bekämpfen, werden nur die Symptome behandelt.

Wie weiter mit der Nutztierhaltung?
Seit dem 24. August 2023 gibt es ein staatliches Tierhaltungskennzeichnungsgesetz für Schweinefleisch, das ab März 2026 greifen soll. Die Kennzeichnung umfasst fünf Stufen, die jeweils die einzelnen Haltungsformen repräsentieren.
Staatliche Tierhaltungskennzeichnung:
- Stufe Stall: Gesetzliche Mindestanforderungen - abhängig von der Gewichtsklasse zwischen 0,5 bis ein Quadratmeter pro Schwein, organisches Beschäftigungsmaterial wie Sägespäne oder Stroh
- Stufe Stall+Platz: Mindestens 12,5 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgegeben, dazu Raufutter und Strukturierung der Ställe durch verschiedene Elemente
- Stufe Frischluftstall: In der letzten Mastphase mindestens 45 Prozent mehr Platz als es das Gesetz vorschreibt, Kontakt zum Außenklima
- Stufe Auslauf/ Weide: Mindestens 100 Prozent mehr Platz in der letzten Mastphase, ganztägige Möglichkeit zum Auslauf im Freien oder dauerhafte Haltung im Freiland
- Stufe Bio: 150 Prozent mehr Platz, Stall mit Stroh oder Naturmaterialien plus Auslauf
Quelle: test.de
Die Kennzeichnung ist gesetzlich geregelt, also verpflichtend – das ist eine Stärke im Vergleich zu den etwaigen privaten Labeln. Außerdem bietet sie Verbrauchenden klare, transparente Angaben über die Haltungsbedingungen. Doch so symbolisch wichtig das staatliche Kennzeichen auch ist, es bleibt zu unwirksam: Zum einen gilt es derzeit nur für frisches Schweinefleisch aus Deutschland – verarbeitete Produkte, Gastronomie, Importware und andere Tierarten bleiben außen vor. Zum anderen kritisiert der BUND, dass gerade die unteren beiden Stufen wenig Verbesserung bringen – z. B. bei Stall+Platz nur 0,2 m² mehr – und damit kaum gerechter sind als der gesetzliche Standard. Außerdem informiert das Kennzeichen lediglich über den Status quo und verpflichtet nicht zur Umstellung.
Wie wär’s mit Bio?
Wer Wert auf artgerechte Haltung legt und hohe ethische Ansprüche hegt, sollte sich mit Bio-Siegeln wie EU-Bio oder Bioland vertraut machen. Laut der Umweltbewusstseinsstudie 2022 ist das EU-Bio-Siegel fast allen der 2000 Befragten bekannt; 10 Prozent achten beim Einkauf immer darauf, 46 Prozent oft bis sehr oft.
Beispiele für Bio-Siegel:
Das EU-Bio-Siegel legt für jede Tierart klare Platzvorgaben fest – etwa 1,3 m² Stallfläche plus 1,0 m² Auslauffläche für ein 110 kg schweres Schwein. Ein Außenklimabereich ist vorgeschrieben. Die Tiere erhalten 100 Prozent Bio-Futter; Gentechnik und die vorbeugende Gabe von Antibiotika sind verboten. Das routinemäßige Kupieren von Ringelschwänzen ist untersagt. Bei Krankheit wird – wenn möglich – auf Naturheilverfahren und Homöopathie zurückgegriffen. Außerdem erfolgen jährlich staatliche Kontrollen.
Das Bioland-Siegel ist nochmal strenger: Das Abschneiden von Ringelschwänzen ist hier grundsätzlich verboten. Außerdem sollen Tiertransporte in der Regel maximal vier Stunden betragen, Ausnahmen sind nur in begründeten Fällen möglich. Zusätzlich zu den gesetzlichen Bio-Kontrollen erfolgen eigene, unabhängige Bioland-Kontrollen.
Quellen: ernaehrungs-umschau.de / greenpeace.de, bioland.de
Was wollen wir für die Zukunft?
Transparenz, Finanzierung, klare Regeln – das fordert Patrick Müller, Agrarexperte des BUND. Zwar tragen inzwischen viele tierische Produkte ein Label, doch kaum jemand blicke durch. Dadurch sei die theoretisch große Macht der Verbrauchenden praktisch nicht umsetzbar, so Müller. Auch, weil sie nicht alle wahrnehmen wollen: Zwar achten inzwischen deutlich mehr Menschen auf Tierwohllabel – ihr Anteil ist seit 2015 von 36 auf 65 Prozent gestiegen –, doch das sind längst nicht alle Verbrauchenden. Zudem muss die Politik handeln: Es bedarf einer vollumfassenden gesetzlichen Haltungskennzeichnung für alle Fleisch- und Milchprodukte – ob verarbeitet oder unverarbeitet, im Handel, in der Gastronomie oder aus dem Ausland. Das wünschen sich laut BMEL-Ernährungsreport 2024 auch 85 Prozent der 1000 Befragten. Darüber hinaus sind finanzielle Anreize notwendig, damit Betriebe für bessere Tierhaltung angemessen vergütet werden.
Das Verständnis für Tierwohl muss wachsen und sowohl in den Köpfen der Verbrauchenden als auch auf politischer Ebene in Denken und Handeln verankert werden. Das sollte es uns wert sein, um Leid zu verringern und Tierwohl zu steigern. Denn am Ende steht die Frage: Wollen wir eine Landwirtschaft, die Tiere respektiert – oder nur eine, die billig produziert?
Deine Meinung interessiert uns
Sehr wichtig - ich achte immer darauf, wenn möglich.
Weniger wichtig - es spielt für mich keine große Rolle.