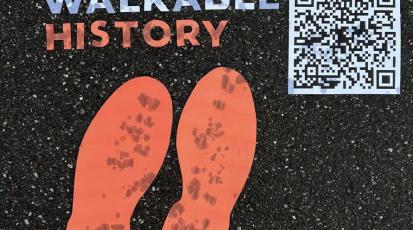"Auf einer normalen Weide würden diese Hochleistungskühe verhungern."
Ene mene Muh und raus ist die Kuh

Hinweis
Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema "Nutztiere in der Landwirtschaft".
Dazu gehören auch:
Knapp 20 Minuten Fußweg vom Deutschen Bundestag entfernt liegt der Hauptsitz des Deutschen Bauern Verbands e.V. (DBV). Etwa 90 Prozent der knapp 255 Tausend Landwirte in Deutschland werden von diesem Verband vertreten. Der DBV ist die Nummer eins unter den Interessensvertretern im Landwirtschaftlichen Gebiet. Nach eigener Angabe ist der Verband „unternehmerisch im Denken, aber bäuerisch im Herzen“. Regionalität, Nachhaltigkeit, Zusammenhalt und Zukunftsfähigkeit - diese Schlagworte fassen das Leitbild des DBV zusammen. Gerade Zusammenhalt scheint wichtig, denn Bauernbetrieb ist nicht gleich Bauernbetrieb. Neben den kleinen Bauern und Bäuerinnen gibt es auch große Betriebe. Diese werden von Deutschland und der EU unterschiedlich sanktioniert.
Die gemeinsame Agrarpolitik der EU
Als Großbäuerin oder -bauer gilt man, wenn die eigene Landfläche 100 Hektar oder mehr beträgt. Im Jahr 2023 waren das nur 15 Prozent aller Landwirt*innen. Diese 15 Prozent bewirtschaften ca. 63 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland.
Die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU zahlt jährlich etwa 6 Milliarden Euro für Agrarsubventionen. Etwa 70 Prozent der Fördermittel für Deutschland sind Flächenprämien, das heißt, je nach Landgröße erhält man mehr oder weniger Geld. Das Subventionsprinzip steht häufig in der Kritik, denn davon profitieren hauptsächlich die Landwirt*innen, die mehr erwirtschaften können.
Der DBV setzt sich beispielsweise für den Bürokratieabbau ein, um auch kleinen Betrieben die Entwicklung zu einer nachhaltigen und ökologischen Landwirtschaft zu ermöglichen. Patrick Müller, vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), schätzt die Realität jedoch anders ein. „Man muss das differenzieren. In den Landkreisen macht er sehr gute und wichtige Angebote für alle Bäuerinnen und Bauern. Egal ob groß, klein, öko oder konventionell.“, erklärt der Experte für Agrarpolitik. „Je weiter man in der Hierachie nach oben geht, desto mehr nimmt das ab“. Dort werde eine Politik vertreten, die, aus Sicht des BUND, überhaupt nicht auf die Kleinen eingehe. „Sie ist sehr stark auf den Export ausgerichtet, damit möglichst viel, möglichst günstig produziert werden kann“, verdeutlicht Müller. Während der Bauernproteste 2024 wurden ähnliche Stimmen, auch von Bauern, laut. Der DBV würde sich stärker auf die Großen konzentrieren. „Und das zeigt sich auch im Personal“, meint Müller. In der obersten Etage des DBV sind die Kleinen nicht vertreten.
Lauter große Bauern
Joachim Rukwied, der Präsident des DBV, übernahm den elterlichen Betrieb und damit 340 Hektar Ackerland, sowie weitere 28 Hektar Weinberge. Für sein Landgut erhielt er im Jahr 2022 rund 109 Tausend Euro von der EU.
Auch bei den Vizepräsidenten Gunther Felßner (160ha Land, 20ha Wald), Holger Hennies (Gemeinschaftsbetrieb mit 650ha), Torsten Krawczyk (ca. 420ha) und Karsten Schmal (ca. 250ha) ist es ähnlich. Als die Süddeutsche Zeitung den DBV mit dem Vorwurf konfrontierte, dass er sich vor allem für Großbetriebe einsetze, wehrte sich der Verband und stellte dies als Blödsinn dar. Eine im Jahr 2019 vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) veröffentliche repräsentative Umfrage zeigt, dass die Mitglieder diese Diskrepanz zwischen der Führungsebene und den Mitgliedern wahrnehmen. 56 Prozent der befragten DBV Mitglieder gaben an, sich eher oder sehr schlecht vom DBV vertreten zu fühlen.
Von den rund 255 Tausend landwirtschaftlichen Betrieben sind knapp 130 Tausend Rinderhaltungen. Etwa ein Drittel der 10,3 Millionen Rindern sind Milchkühe. Diese produzieren insgesamt ungefähr 32 Millionen Tonnen Milch im Jahr und machen Deutschland dadurch zum größten Milcherzeuger der EU. Über die richtige Behandlung und Haltung der Kühe gibt es teils unterschiedliche Ansichten.
Vor allem die Zucht von Nutztieren ermöglicht eine hohe Milchproduktion. Verschiedene NGO‘s kritisieren die wirtschaftlich ausgerichtete Zucht bei Kühen. Laut Greenpeace kann diese zu Gesundheitsschädigungen wie Stoffwechselstörungen, Unfruchtbarkeit, Euterentzündungen oder Klauenkrankheiten führen. Patrick Müller sieht das ähnlich: „Auf einer normalen Weide würden diese Hochleistungskühe verhungern“. Die Tiere benötigen ein bestimmtes Futter mit hohen Getreideanteilen. Allerdings kann die Kuh dies nicht richtig verarbeiten, da ihr Magen auf eine regelmäßige Grasfütterung ausgelegt ist. „Das hat inzwischen auch die Landwirtschaft festgestellt und fängt an, ein Stück weit umzusteuern und wieder auf die Lebensleistung zu gehen“, erklärt Müller. "Die Tiergesundheit soll stärker berücksichtigt werden. Aus unserer Sicht muss die Zucht wieder zu einem robusten Rind gehen, das für die Weidehaltung geeignet ist“, stellt er klar.
In einem Dokument zum Zuchtverfahren bezieht sich der DBV auf den Richtwert „Richtig-Züchten-Gesund“ (RZG). Der DBV hält den RZG für einen guten Messwert, da er alle wichtigen Schwerpunkte des Züchtens vereine. Die Milchleistung hat allerdings im RZG den höchsten Stellenwert und mit 36 Prozent auch den Doppelten der Tiergesundheit (18 Prozent).
Das Tierschutzgesetz und die Anbindehaltung
Ein weiterer strittiger Punkt ist die Haltung der Milchkühe. Mögliche Haltungsformen sind die Weidehaltung, die Laufhaltung und die Anbindehaltung. Knapp zehn Prozent der deutschen Milchkühe werden in Anbindungsställen gehalten.
Anbindehaltung
Wie der Name schon preisgibt, sind die Kühe in diesen Ställen dauerhaft angebunden, beispielsweise durch Ketten. Sie können sich kaum hinlegen, sind eng nebeneinander angereiht und eine freie Bewegung ist nur teilweise in einem Auslauf oder auf der Weide möglich. Mehrere Umwelt- und Tierrechtsorganisationen fordern eine Abschaffung der Anbindehaltung.
Quelle: bmel
2023 veröffentliche Greenpeace ein Rechtsgutachten über die Verstöße gegen das Tierschutzgesetz (TSchG) in der Anbindehaltung. Die Tierhaltungsgeneralklausel aus dem TSchG besagt, dass die Grundbedürfnisse der Tiere nicht eingeschränkt werden dürfen. Diese beziehen sich auf die Bereiche Ernährung, Ruheverhalten, Eigenkörperpflege und Sozialverhalten. Die Anbindehaltung greift, laut dem Gutachten, in alle Grundbedürfnisse ein.
Eingriffe in die Grundbedürfnisse
In einer natürlichen Umgebung liegen die Kühe sieben bis 12 Stunden am Tag auf einer verformbaren und trockenen Liegefläche. Die Liegeflächen in der Anbindehaltung sind, nach den Recherchen von Greenpeace, zu hart. Der Platzmangel verhindert die natürliche Liegeposition der Tiere. Durch die Beeinträchtigungen im Liegeverhalten kann es bei den Kühen zu Gelenk- oder Euterentzündungen, Verletzungen an den Schenkeln und Schäden am Bewegungsapparat kommen. Kühe sind soziale Tiere, in einer Herde können langjährige Freundschaften entstehen. Trotzdem halten sie auch gerne Abstand zueinander. Wenn sie eng nebeneinander angebunden sind, ist dies unmöglich. Die Beziehung zwischen Mutter und Kalb ist sehr wichtig und entsteht direkt nach der Geburt. In der Natur sondert sich die Mutter von der Herde ab, um ihr Kalb zu gebären und verbringt anschließend viel Zeit mit ihm. Im Anbindestall ist die Absonderung nicht möglich außerdem werden Mutter und Kalb direkt nach der Geburt getrennt. Laut Greenpeace kann dies zu enormem Stress bei der Mutterkuh führen. Eine natürliche und artgerechte Nahrungsaufnahme sowie die eigene Körperpflege sind im Anbindestall ebenfalls nicht umsetzbar.
Gescheiterte Versuche
„Rinder gehören nicht angebunden, Punkt“, fasst Patrick Müller zusammen. „Die Zahl der Betriebe mit Anbindehaltung nimmt zwar schon ab, sie wird aber nie ganz auf null sinken“, erklärt er. Letztes Jahr sollte das TSchG angepasst und ein Verbot für die ganzjährige Anbindehaltung bis 2034 festgelegt werden. „Diese Änderung ist leider gescheitert, weshalb wir damit noch eine ganz große Baustelle haben“.
Neben der ganzjährigen gibt es noch die saisonale Anbindehaltung oder Kombihaltung. „Auf solche Wortspielereien mag ich mich gar nicht einlassen“, meint Müller. „Ob das eine Öko-Kombihaltung, eine saisonale Anbindehaltung ist oder was auch immer. Das gehört aus unserer Sicht ganz klar und direkt verboten“. Eine Anbindehaltung mit Weidegang ermöglicht zwar mehr Bewegungsfreiheit für die Tiere, dennoch stehen sie durchschnittlich bis zu 8 Monate im Jahr durchgehend angebunden im Stall.
Der Deutsche Bauernverband bezieht Stellung
Der Deutsche Bauernverband veröffentlichte 2017 eine Stellungnahme zur Anbindehaltung hinter der er heute noch steht. Die Haltungsform werde hauptsächlich von kleineren Betrieben angewendet und übernehme eine unverzichtbare Aufgabe für den Klima- und Bodenschutz und den Erhalt der Artenvielfalt. Dennoch spricht sich der Verband dafür aus, die Landwirt*innen bei einem Abbau der Anbindehaltung zu unterstützen, er sei aber gegen ein Verbot. Dieses würde für einen Strukturumbruch des ländlichen Raums und Wettbewerbsnachteile im europäischen Binnenmarkt sorgen. Auf die geplanten Änderungen im TSchG reagierte der DBV-Präsident Ruckwied mit einem Brief an die Länder. Darin kritisierte er die vorgeschlagenen Veränderungen in der Milchviehhaltung, diese seien „nicht akzeptabel“.
Der DBV wägt als größter Bauernverband zwischen Zusammenhalt, Profit und Tierwohl ab. Nicht immer wird er mit seinen Entscheidungen den Vorstellungen seiner Mitglieder oder Tierschutz-Organisationen gerecht.